Gedanken sind mächtig, sie können beflügeln und zu (neuen) Höchstleistungen verhelfen. Doch Gefühle können auch täuschen und lähmen. Den Unterschied verrät Denis Mourlane in seinem Buch…
Sie möchten sich im Bereich der emotionalen Führung weiterentwickeln. Unsere Emotionen sind sehr häufig ganz ausgezeichnete Ratgeber. Wenn jemand eine Woche vor einer wichtigen Prüfung immer noch nichts gelernt hat und nachts schweißgebadet und voller Angst aufwacht, dann ist das eine Reaktion, die ich als emotional intelligent bzw., ich führe einen neuen Begriff ein, als emotional reif bezeichne.
Schließlich steht viel auf dem Spiel für die Zukunft, wenn derjenige die Prüfung nicht besteht. Vielleicht ist er ja schon einmal durch die Prüfung gefallen und es ist seine letzte Chance, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen.
Seine Angst sagt ihm dann, dass es nun wirklich höchste Zeit ist, mit dem Lernen zu beginnen. Wer aber schon sechs Monate vor der Prüfung vor lauter Angst nicht mehr schlafen kann und permanent von lähmenden Gedanken an ein Versagen und von Selbstzweifeln geplagt ist, zeigt eine emotional unreife Reaktion. Insbesondere dann, wenn die Person in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen hat, dass sie alle Fähigkeiten besitzt, die Prüfung mit Bravour zu bestehen.
Gefühle, ein guter Ratgeber?
Wie Sie auch daran erkennen können, sind unsere Emotionen häufig, aber eben nicht immer gute Ratgeber für unser Handeln. Was vor allem daran liegt, dass sie in sehr hohem Maße von der Art und Weise, wie wir sozialisiert wurden, den daraus entstandenen Wertvorstellungen und somit unserer Art, über uns und die Welt zu denken, abhängen.
Wenn jemand also so denkt – ich möchte es als inakkurat, also der Situation wenig entsprechend, oder eben unreif bezeichnen – bzw. solche Wertvorstellungen hat, dann wird er auch inakkurate Gefühle haben bzw. unreif fühlen.
≫Nachrichtenticker in unserem Kopf≪
Diese Erkenntnis ist wichtig, weil die meisten Menschen einen deutlich besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben als zu dem, was sie denken. Wir können zwar mit etwas Konzentration unsere Gedanken, den ≫Nachrichtenticker in unserem Kopf≪, wahrnehmen (und uns im Übrigen über das, was uns da so durch den Kopf schwirrt, manchmal ganz schön wundern und amüsieren), aber häufig sind diese Gedanken doch sehr flüchtig, wenig greifbar.
“Emotionen sind mächtig”
Das ist bei unseren Emotionen weniger der Fall, insbesondere dann, wenn diese sehr stark werden. Starker Ärger etwa ist sehr präsent, er kann von den meisten Menschen auch entsprechend benannt werden und ist, anders als unsere Gedanken, auch nicht gleich wieder weg.
Er dauert an. So haben wir dann auch, wenn wir ein paar Mal durchgeatmet und uns nicht gleich vom Ärger haben mitreißen lassen, die Möglichkeit zu reflektieren, ob dieses Gefühl nun reif bzw. akkurat ist. Wir haben, anders ausgedrückt und um bei der Sprache der Emotionen zu bleiben, also im Falle von Ärger die Möglichkeit zu überprüfen, ob unsere Rechte gerade wirklich so stark verletzt werden, wie es uns die Stärke der Emotion signalisiert.
Eigene Wertvorstellungen
Liegt es wirklich an der Situation oder ist es nicht vielleicht doch eher eine verquere Sichtweise, die dazu führt, dass wir gerade so starke Emotionen empfinden? Diese zutiefst menschliche Empfindung der Angemessenheit hat, ohne dass es der überwiegenden Mehrheit bewusst wäre, schon längst ihren Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden. Auch in Ihren.
Das äußert sich in Sätzen wie ≫Du hast recht, stolz zu sein!≪, ≫Du hast recht, dich zu ärgern≪ oder ≫Du hast recht, traurig zu sein≪. Das Wort ≫recht≪ bedeutet nichts anderes, als dass die Person, die den Satz sagt, die empfundene Emotion für richtig, also akkurat und der Situation angemessen hält. Sie nimmt eine auf ihren ganz eigenen Wertvorstellungen basierende Bewertung vor.
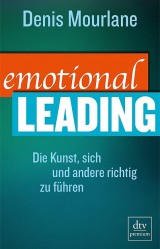
In diesem Fall passen die Wertvorstellungen der beiden Personen zusammen. Interessanterweise wird diese Bewertung aber häufig nur dann geäußert, wenn jemand mit der Emotion des Gegenübers einverstanden ist.
Ist dies nicht der Fall, halten sich viele Menschen lieber bedeckt, da sie mit Aussagen wie ≫Ich sehe eigentlich keinen Grund dafür, so stolz zu sein≪ oder ≫Ich finde, du übertreibst es mit deiner Angst≪ dem Gegenüber doch sehr nahetreten. Wie haben Sie das letzte Mal reagiert, als Ihnen jemand gesagt hat, dass Sie sich zu sehr über etwas aufregen?
Die wenigsten hören gerne, dass sie falsch fühlen. Und das, obwohl in solchen Aussagen deutlich mehr Erkenntnispotenzial stecken könnte als in einer Bestätigung der Richtigkeit des emotionalen Zustandes, die im Übrigen häufig auch nur Mitgefühl zeigen soll. Sie können also den emotionalen Zustand des Gegenübers beobachten, mit seiner persönlichen Situation abgleichen und nehmen ganz automatisch und unbewusst eine Bewertung bezüglich der Richtigkeit dieser Emotion vor.
Entsprechend sollte also auch nichts dagegensprechen, dies alles bei sich selbst zu tun. Oder? Wir kennen, vereinfacht ausgedrückt, drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Mensch im Verhältnis zu einer Situation emotional reagieren kann.
Das Sechs-Kreise-Modell

Zwei davon sind inakkurat, also unreif, und eine davon ist akkurat. Ich habe versucht dies mit dem ≫Sechs-Kreise-Modell≪ darzustellen und verwende dieses auch sehr gerne in Trainings und Coachings, da es leicht verständlich ist.
In den weiter oben geschilderten Beispielen handelt es sich um akkurate Emotionen, also Schuldgefühle nach einem Diebstahl bzw. Angst eine Woche vor einer wichtigen Prüfung.
Im einen Fall wurde gegen festgelegte gesellschaftliche Normen verstoßen und im anderen Fall droht tatsächlich eine Gefahr. Würde man hundert Menschen fragen, ob diese Gefühle ≫zu Recht≪ bestehen und ob sie in ihrer Größe angemessen sind, würden wahrscheinlich alle die Frage mit Ja beantworten. Und wären es nur 95, würden wir immer noch von einer akkuraten Reaktion sprechen. In Bezug auf die inakkuraten Reaktionen gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann die Emotion deutlich kleiner sein, als es angemessen erscheint (im Modell die beiden Kreise unten).
Das wäre der Fall, wenn jemand nur sehr geringe Schuldgefühle hat, nachdem er einem Bekannten etwas gestohlen hat. Außer die Person hat einen sehr guten Grund dafür, ist dies eine emotional unreife Reaktion. Andererseits kann die Emotion überzogen sein.
Auszug aus: Denis Mourlane, “Emotional Leading: Die Kunst sich und andere richtig zu führen”, © 2015 dtv Verlagsgesellschaft, München.
Artikelbild: ScandinavianStock/ Shutterstock

















